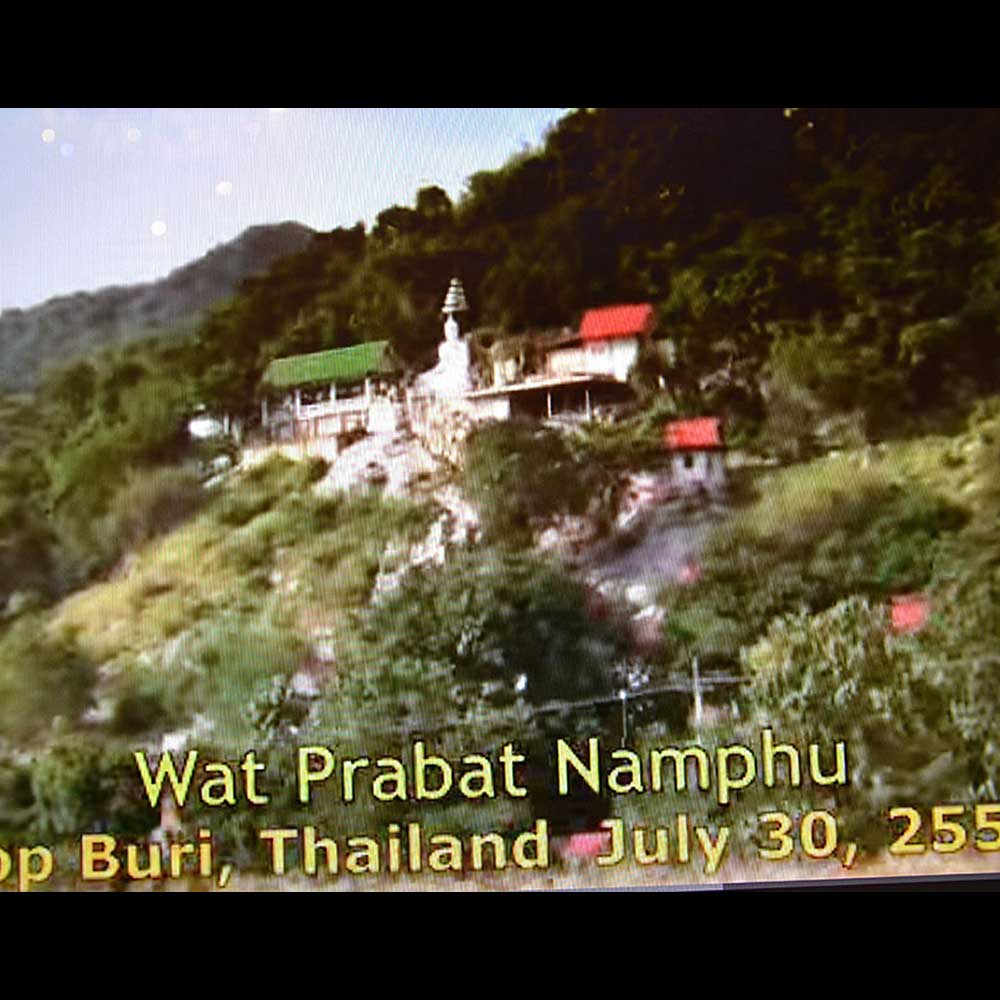ÖBAHO HILFT AIDS-Kloster in Lopburi
DURCH IHRE SPENDE WIRD VIEL MÖGLICH – HELFEN SIE MIT!
UNSER SPENDENKONTO: ÖBAHO
Bankverbindung: BAWAG/PSK
IBAN: AT21 6000 0803 2026 2341
VERWENDUNGSZWECK: AIDS KLOSTER

Weiterhin wollen wir das Sterbehospitz und AIDS-Kloster, einmal jährlich, unterstützen.
Einfach nur über die Stirn des Vogelgesichts streichen
von Andreas Altmann
Die Aufnahme zeigte das Gesicht eines Mannes, das eine fremde Hand streichelte. Das Gesicht lag auf einem Kopfkissen und sah jung und verwüstet aus. Die Hand sah jung und gesund aus. Der Text darunter: „Aids-Patient in Thailand.“ Sonst nichts. Das Bild stand in einem amerikanischen Magazin. Ich rief den Fotografen James Nachtwey an und fragte ihn nach dem Ort, wo er das Gesicht und die Hand fotografiert hatte: In einem buddhistischen Kloster, zwei Zugstunden von Bangkok entfernt. Kurz darauf kam ich dort an, als Reporter. Zu spät, natürlich. Der Mann war bereits tot. Die Hand, erfuhr ich, gehörte „Christina“, einer Frau aus Europa. Sie war inzwischen abgereist. Sie hatte hier gearbeitet. Ich wollte ihr sagen, wie sehr mich diese Geste berührt hatte. Und ihr einen Satz von Jean Cocteau schenken: „Es gibt keine Liebe, nur Beweise der Liebe.“ Ein trockener Satz, der das Betroffenheitsgestammel von Handlungen unterscheidet, die Wärme und Nähe produzieren. Sommer 2002, drei Jahre später, bin ich wieder im Kloster Prabat Nampu. Nicht als Reporter, sondern als „volunteer“, als „Freiwilliger“, als einer, der das „Aids Hospice“ ein paar Wochen verkraftet. Wie andere vor mir. Als Handlanger und Hilfskraft. Die Mittel sind knapp. Jeder, der Windeln wechseln und ein oder zwei Tote pro Tag aushält, ist willkommen. Verschiedene Motive drängten zu diesem Entschluss.
Im Sudan antwortete eine kanadische Ärztin auf meine Frage, warum sie sich den Bürgerkrieg und die Malaria zumutete: „Es wurde Zeit, dass ich etwas zurückgebe.“ Noch ein trockener Satz. Er passt zu jemandem, der in einer der Luxusnationen wohnt. So eine leise, penetrante Stimme kommt da zu Wort, die zum Teilen auffordert. Nicht gleich alles, aber etwas, das schon. Noch ein Impuls lässt mich zurückkommen: mein Zynismus. Ich will wissen, ob das Hospiz noch immer mit dem Treibstoff arbeitet, den der Abt in einem Interview damals erwähnte: „Compassion“, so eine buddhistische Ausgabe von Mitgefühl. Eben mitfühlen mit dem, dem es dreckig geht. Oder ob die Entertainment-Nutten schon angeklopft haben. Damit aus dem Dritte-Welt-Laden endlich ein Geschäft wird. Ob schon ein Big-Brother-Big-Aids-Format im Gespräch ist: „Wer verreckt als Erster? – Wer fliegt zuerst? – Wer röchelt am längsten?“ Von alldem nichts. Als ich an einem Montagmorgen das Gelände betrete, hat sich an der Anmut nichts verändert. Das Kloster liegt noch immer am Fuße einer dicht bewaldeten Hügelkette, ein paar Kilometer außerhalb der Stadt Lopburi. Flachbauten mit hellgrünen Dächern stehen zwischen Akasia-Bäumen und Bougainvillea-Sträuchern. Von einem der Gipfel blickt eine weiße Buddha-Statue. Ein fauler Hund liegt in der Sonne, Vögel schwirren, von fern klingt ein verdächtiger Huster. Stille.
Als erster Mensch läuft mir Mister Thawin über den Weg, der „cremation man“. Er verbrennt hier seit Jahren die Leichen. Er trägt noch immer sein Walkie-Talkie am Gürtel, er muss erreichbar sein, Tote riechen in der Hitze. Thawins Arbeitsplatz scheint gesichert. Dass ich ihm zuerst begegne, wie sinnig. Als begänne am Tor ein Crashkurs in Buddhismus: Mach dir keine Illusionen, wer hier landet, muss sterben. Problemlose Anmeldung, in Thailand lächeln sie, wenn sie einen Fremden sehen. Ein Formular mit Namen und hiesiger Anschrift ausfüllen. Dazu die Bitte, ein Blatt zu lesen, auf dem unmissverständlich die „regulations“ stehen, Auszüge: Achte auf deine Sprache, sei dir der „Gefahr eines Wortes“ bewusst. Keine Gewalt, auch keine verbale, gegen Mensch und Tier. Keine Drogen, kein Alkohol, keine Zigaretten, kein Sex auf dem Gelände. Das Kloster übernimmt keine Verantwortung für etwaige Verletzungen und Infektionen. Respektiere den Glauben jedes Patienten, jeder Versuch, ihn zu ändern, ist untersagt. Jener letzte Punkt scheint besonders wichtig. Man fasst nicht, welches Missionarsgesindel sich hierher verirrt, um den armen Teufeln ihre allein selig machenden Wahrheiten einzubläuen. Hilfreich wäre, sich auf den Augenblick vorzubereiten, in dem man den Raum mit den Aids-Kranken betritt. Erdgeschoss, ein Mittelgang, links und rechts die knapp vierzig Betten. Wer hier liegt, liegt im Endstadium. Vor dem Ausgang stehen die gestapelten, noch leeren Särge, jeder sieht sie jeden Tag, jeder weiß, dass keiner davonkommt.
Der Tod ist launisch, manchmal holt er sich sechs Stunden nach Einlieferung sein Opfer, manchmal nach sechs Monaten. Von den Krankenschwestern, die 1999 hier gearbeitet haben, sind alle weg. Nicht verstorben, aber erschöpft von den Zumutungen, denen auf Dauer die wenigsten standhalten. „Golf“ – Thais lieben Kosenamen – begrüßt mich scheu, die neue Oberschwester reicht Mundschutz und die „Anan Balm“-Creme. Das ist ein Augenblick wunderbaren Einverständnisses. Frage irgendeinen, der Tage und Nächte im Bett liegt, was er sich am innigsten wünscht, und er wird antworten: „Eine Massage.“ Weil sie ein Wohlgefühl verbreitet, weil sie die Blutzirkulation in dem verkümmernden Leib stimuliert, weil einer spürt, dass ein anderer sich um ihn kümmert. Das ist ein besonderer Moment. Denn alle Patienten, die noch die Kraft haben, schauen auf den Neuen. Mit Sympathie und Zurückhaltung. Sympathie, weil sie wissen, dass die meisten Fremden kommen, um Tätigkeiten zu verrichten, die ihnen gut tun. Zurückhaltung, weil sie auch wissen, wie sie aussehen, schon erfahren haben, dass sie Schrecken und Widerwillen auslösen. Zuletzt: Jemanden anfassen, meist noch auf bloßer Haut, ist ein intimer Vorgang. Er bleibt es, selbst wenn er medizinisch gerechtfertigt ist.
Niu hat Nachsicht mit mir und lächelt herüber. Als ich auf ihn zugehe, heben zwei andere bereits die Arme, sie wollen sich anmelden. In Prabat Nampu muss keiner intensiv nach Arbeit suchen, sie wartet vierundzwanzig Stunden auf ihn. Niu hat Charme. Während ich seine Beine einreibe, klärt mich der Achtundzwanzigjährige auf. Das ist seine Art, uns zu entspannen: „I am ladyboy“, sagt er nonchalant. In Thailand heißen so jene Männer, die lieber als Frauen auf der Welt wären. Viele verbringen ihr Leben als Transvestiten, viele werden Transsexuelle und lassen sich operieren. Niu fasst mit Stolz an seinen Kunstbusen: „Hat mich 47 000 Bath gekostet“, knapp 1 200 Euro. Fürs „cutting“, so nennt er das, fürs Entfernen des Gliedes, besaß er kein Geld mehr. Auch kam die Krankheit. Ladyboys gehören zu den Gefährdetsten im Land, die meisten verdingen sich als Prostituierte. Was ihnen eher leicht fällt, denn – die Massage zieht sich, Niu sucht listig nach Worten – die neugeborenen „Frauen“ müssen sich immer wieder bestätigen, dass sie als Frauen begehrt werden. Jeder hungrige Blick auf sie, jeder Geschlechtsakt ist ein Beweis für ihr neues Leben.
Auf die Frage, wie er es mit dem Einsatz von Kondomen gehalten hat, entkommt dem hübschen Zwitter ein abschätziges: „Don t like.“ Niu will niemand belasten, auch nicht sich selber. Er glaubt noch nicht an den Tod. Auch wenn er täglich am Tropf hängt. Seine Haut wurde bisher von (sichtbaren) Verwüstungen verschont. Den Verlust von zwanzig Kilo Fleisch will er nicht sehen. Drei Betten hinter ihm liegt Huang. Sie hat sich vorher nicht gemeldet, sie kann nicht mehr. Aber Nuden, eine der Krankenschwestern, deutet auf sie. Huang liegt auf dem Rücken, abgezehrt wie ein verhungernder Vogel, ihre abgewinkelten Arme und Beine ragen wie schmutzig graue Latten in die Luft. Als sie mein Gesicht wahrnimmt, bewegt sie den Zeigefinger langsam Richtung linke Schläfe. Das wird unsere Geste für die nächsten Wochen, sie ist stumm und eindeutig: „Bitte, eine Kopfmassage.“ Mit 133 Zentimeter Körpergröße wurde die 61-Jährige eingeliefert. Jeden Tag scheint sie zu schrumpfen. In ihrer Krankenakte ist unter „Wie infiziert“ der dritte Kreis angekreuzt. Weder ungeschützter Sex, noch eine dreckige Heroinnadel, Ursache: „unbekannt“. Weiter unten steht: „Nach dem Tode niemanden verständigen.“ Der Satz kann verschiedene Gründe haben: Huang hat keine Verwandten. Oder: Die Familie will nichts wissen von ihr. Möglich auch: Die Kranke schämt sich ihres Zustands und keiner soll davon erfahren. Sacht über die Stirn des Vogelgesichts fahren. Später über Wangen, Kinn, den Nacken.
Herausfinden, wie viel Druck Wohlbefinden verschafft und wo der Schmerz anfängt. Ungeschriebenes Gesetz: Eine Massage dauert mindestens fünfundvierzig Minuten. So haben beide Seiten Zeit, sich aufeinander einzustellen. Keine AOK-Knete im Zeitraffer mit Stoppuhr, dafür beharrlich und ausdauernd sich auf einen Körperteil nach dem andern konzentrieren. Irgendwann zahlt die winzige Ex-Schneiderin mit dem Besten, was ein Masseur verlangen kann. Sie schläft ein. Ein paar Schritte von den Krankenbetten entfernt steht ein kleiner Kiosk, im Schatten, mit einem Kühlschrank. Nach zwei Patienten, nach zwei Massagen ist eine Pause fällig. Um eine eiskalte Flasche Limonade an das schweißgebadete Gesicht zu drücken. Im Sommer ist Regenzeit in Thailand, das Thermometer zeigt 37 Grad, die Luftfeuchtigkeit liegt bei zweiundachtzig Prozent. Ich treffe Mali, eine junge Japanerin aus Yokohama, sie hat „Vergleichende Literaturwissenschaften“ studiert und arbeitet ebenfalls als Hilfsmasseurin und Putzfrau im Kloster. Ich werde sie später (diskret) beobachten und etwas Wichtiges von ihr lernen. Jetzt verführt sie zu schallendem Gelächter, weil sie wissen will, ob stimmt, was sie in einer japanischen Zeitung über die Werbestrategien der deutschen Bundesbahn gelesen habe: „Wer sich als frisch vermähltes Paar vor dem Eingang zum Bahnhof küsst, darf umsonst fahren.“ Mali wird eine besondere Erfahrung. Oft strahlt sie Heiterkeit aus, so eine stille Power, so etwas gleichschwebend Starkes, das sich nicht irritieren lässt.
Tief atmen und die zwanzig Meter zurückeilen, an den Särgen vorbei und mit keiner Pore dem Geruch des Elends ausweichen können. Einer Mischung aus warmem Urin und warmem Kot, vollen Windeln, Erbrochenem in den Spucknäpfen, Darmwinden, die wie träge Stinkbomben von einer Ecke zur andern wabern. Dazu das Stöhnen, die Hustenanfälle, die Schreie nach Hilfe, die Stimmen der Träumenden, das Stammeln der Schwermütigen, die Monologe von wirr gewordenen Einsamen. Ich schließe die Augen, will eine Ahnung bekommen vom Leben und Sterben hier, monatelang, jahrelang. Der Versuch scheitert, man braucht jedes Gramm Energie, um es mit der Gegenwart aufzunehmen. Ich komme zur rechten Zeit. Eo, Nuden und Oy, die drei Krankenschwestern, reinigen gerade Patienten und Betten. Nuden hat sich vorgenommen, keinen Fremden zu schonen, sie zeigt auf Supanchai, der Mann liegt unübersehbar in seinen Exkrementen. Wie vor zwei Stunden, wie in zwei Stunden wieder. Ihr Kopfnicken soll mich ermuntern. Ich zucke und beschließe, einen Tag Anlauf zu nehmen. Auch war ich nie Vater, habe keinen Schimmer von Windeln aufmachen und Windeln zumachen. Mutmaße auch, dass es uns allen hilft, wenn man sich erst an ein anonymes Gesicht gewöhnt. Stellt sich doch wieder die Frage nach der Intimität. Was denkt so ein Mensch, wenn ein Unbekannter ihn auspackt, ihn so hilflos erlebt, ihn an den privatesten Körperstellen berührt?
Einer fällt aus dem Bett, das Seitengitter war nicht oben. Es gibt ein seltsames Geräusch, wenn ein Knochengerüst auf dem Fußboden ankommt. Es klirrt, ähnlich Glastuben, die nicht brechen. Ich hieve den Pechvogel zurück, das lenkt ab, um Supanchai kümmert sich Oy, ich bekomme den Tag Schonfrist. Am späten Nachmittag massiere ich Gampa, zu einem großen Fötus ist ihr Körper geschmolzen. Sie ist vierundzwanzig und ihr Gesicht sieht aus wie vierzehn. „Sexworker“, steht in ihrer Akte, das Mädchen hat sich beim Straßenstrich den Virus geholt. Da Thai-Männer gern betrunken der schnellen Liebe nachgehen, scheint oft nicht der Wille vorhanden, nach einem Präservativ zu greifen. Ein Ring aus Schorf rahmt Gampas Gesicht. Schwarze Kruste wuchert über die Ohren, über Teile der Wangen, kriecht unaufhaltsam Richtung Augen. Nach der Stunde umarmt mich Gampa – ich denke aus Dankbarkeit – und drückt ihre Finger auf meinen Rücken. Verstanden: Schon dankbar, aber vorher wäre noch eine Rückenmassage fällig. Es wird die letzte in ihrem Leben. Morgen wird Gampa sterben. Fröhlicher nächster Vormittag. Mit Einblicken in schwärzesten Humor.
Fünf Ladyboys sitzen zusammen und schminken einander, zupfen sich die Barthaare, tragen Lidschatten auf, stecken eine Blume hinters Ohr. Diese Sehnsucht nach schön sein wollen, sie macht zweifellos resistenter. Ich frage, ob in der vergangenen Nacht jemand gestorben sei. Nein, niemand. Dann zeigt Hamna, schon lachend, auf das offensichtlichste Wrack unter ihnen und sagt jubelnd: „Doch, er!“. Jetzt freudigstes, krächzendes Gehüstel, aber von allen, auch vom Wrack. Ein Tag wird kommen, da singt jemand im Radio „Happy Birthday to you“, und einer der Patienten hat den Witz und schmettert: „Happy Deathday to you!“ Todkrank sein und noch immer geistreich, man kann nur staunen und lernen. Gespräch mit dem Abt Tikkapanyo. Er verfügt wie stets über diese spektakuläre Konzentration: Er spricht, wenn er spricht, er hört zu, wenn er zuhört. Ein Leben liegt hinter dem knapp Fünfzigjährigen: Ingenieursstudium in Australien, anschließend in Thailand ein Versager, verlassen von einer Frau, Trunksucht, Autounfälle, ein langer Krankenhausaufenthalt. Nach Monaten kommt er zur Besinnung. Er beschließt, Mönch zu werden, und setzt sich sechs Jahre in eine Höhle. Meditieren, klar werden. Als er klar ist, begreift er, dass In-einer-Grotte-Hocken der Welt nicht weiterhilft. Er verlässt die Einsamkeit und begegnet, eher zufällig, einem siechenden Aidskranken. Das wird seine Aufgabe,
1992 zimmert er aus einem verlassenen Tempel ein erstes Nothilfe-Lager. Acht Patienten damals, heute befinden sich zweihundert in Prabat Nampu. Wer noch gehen und sich selber waschen kann, lebt in sauberen Baracken, mit Nasszelle und kleiner Veranda. Keiner wird hier gerettet, aber jeder soll eine Umgebung vorfinden, in der er in „Frieden und Würde“ sterben kann. Tikkapanyo spricht nie das Wort Moral aus, nie ist Aids eine Strafe Gottes, nie eine Strafe, immer ein Unglück. Auch züngelt er nicht versessen gegen Sex und Drogen. Wenn er mahnt, dann zu Vorsichtsmaßnahmen und Hilfsbereitschaft. Das Unternehmen lebt von Spenden, seit zehn Jahren tingelt er übers Land und bettelt um Großzügigkeit. Noch immer scheint der Ort wie unter Quarantäne zu stehen, noch immer gelten nicht die Faustregeln des Neoliberalismus, noch immer bleiben die Aufrufe zu Habgier und Protz außer Kraft. Die Tage vergehen. Am zehnten bin ich zweieinhalb Kilo leichter, die Hitze, die Schweißströme, der tägliche Anblick von denen, die achtundvierzig Stunden lang abkratzen, bevor sie sterben dürfen. Meine Haut bedecken rote und weiße Pusteln, die Krätze plagt sie, ein gemeiner Juckreiz nervt. Das sind die Momente, in denen ich verstohlen nach Mali blicke. Um Beharrlichkeit zu bewundern. Weil sich die Japanerin mit unfehlbarer Aufmerksamkeit um die spindeldürren, wie von rissigem Pergamentpapier überzogenen Extremitäten der Kranken kümmert. Sie ist „da“, vollkommen anwesend. Ein belgischer Arzt arbeitet in Prabat Nampu, seit über zwei Jahren.
Er ist zuständig für die sechzig Kranken im Hospiz 2, dem Neubau. Warum er durchhält? Ohne Gehalt, ohne Absicherung? Yves bleibt vage, erwähnt sein nagendes Gewissen, seine gescheiterten Fluchtversuche, weiß, dass es keinen Vorgänger gab und so bald keinen Nachfolger geben wird. So mancher kam, um nach kurzer Zeit wieder abzurauschen. Ärzte wollen Leben retten, nicht ihren Patienten beim Sterben zuschauen. Der Fünfundvierzigjährige kann auf eine Tuberkulose und schwere Melancholie-Schübe zurückblicken. Er nimmt Prozac. Prabat Nampu fordert, und wirkt zu gleicher Zeit, so meint er wörtlich, „wie ein High“: Weil es in tiefste Empfindungen führt. Weil Einsichten auf einen warten, die ein Leben reich machen. Hier passiert das Gegenteil von virtuell, von spaßig, von lauwarm. Für die Therapie der Dreierkombination haben sie im Kloster kein Geld, Yves verabreicht Antibiotika, bekämpft mit den vorhandenen Mitteln die so genannten „opportunistischen Infektionen“, die über den immunschwachen Körper herfallen. Droht jemand vor Schmerz in den Irrsinn zu gehen, verabreicht er heimlich ein Morphiumzäpfchen. Wenn vorhanden. Heimlich, da das Hospiz kein Krankenhaus ist, somit die Lizenz für schwere Betäubungsmittel fehlt.
Der Arzt lobt die holländischen und deutschen Freiwilligen, die ihn – auch still und unauffällig – mit dem Medikament versorgen. Yves hat Erfahrung, oft sieht er, wenn es zu Ende geht. Eines Vormittags holt er mich an ein Bett und bittet, „à accompagner la mourante“, die Sterbende zu begleiten. Auch das Politik des Hauses: Keiner soll allein sein beim Weggehen. Ganz praktisch – einfach dasitzen, die Hand nehmen, Zeit haben. Taweens Hände sind bereits kalt und blutleer. Aber die 28-Jährige – laut Unterlagen von ihrem Ehemann angesteckt – atmet noch. Sie schläft mit halb geschlossenen Augen. Dazwischen lange Pausen, dann ein Ruck, wieder springt das Herz an. Eine halbe Stunde lang der immer gleiche Rhythmus, dann plötzlich ein Gurgeln, zwei, drei Konvulsionen des Körpers, das Ende. „Einen schönen Tod“, nennen sie das hier. Weil ohne Bewusstsein, ohne Schreie, ohne den Wunsch, am Leben zu bleiben. Dennoch, sterben neben einem wildfremden Menschen, ist das schön? Andere Patienten haben mehr Glück. Wie der freundliche Paipun, der sich nach jeder frischen Windel mit dem Wai, dem Händefalten vor dem Gesicht, bedankt.
Als ich heute vorbeikomme, umarmt eine Frau seinen nackten, geschundenen Oberkörper. Wir begrüßen uns, sie sagt: „Ich bin sein Freund“. Das ist ein guter Satz. Nicht Freundin, nicht Frau, einfach: Freund. Als ob Sajee von Henry Millers Bemerkung wüsste: „Freundschaft ist etwas jenseits von Liebe“. Die junge Frau versteckt ihre Augen hinter einer Sonnenbrille, wendet sich manchmal ab. Da mag einer tausend Mal an die Wiedergeburt glauben, tausend Mal an ein Nirvana und seinen ewigen Frieden: Aber jetzt stirbt einer, der geliebt wird. Der ein Freund ist. Diesen Schmerz beschwichtigt augenblicklich nichts, keine Religion, keine Philosophie, keine Sprache, nichts. Jeden Tag bin ich bei Noy, auch heute, am letzten. Er mag meinen Bizeps anfassen, ich mag sein skeptisches Grinsen. Der Ex-Gemüsehändler hat gerade eine wuchernde Krätze hinter sich, die Haut blättert. Unübersehbar sein hellrosa Penis, den Pilze, Herpes und eine Horde Bakterien heimsuchen. Am schwerwiegendsten: Den 33-Jährigen treibt nichts mehr an, seit einer Woche knebelt ihn eine stumm machende Depression. Ich soll mit ihm spazieren gehen, so der Arzt, damit die Lebensgeister zurückkehren. Nicht leicht, wenn einer zusehen muss, wie ihm täglich der Leib abhanden kommt. Wir fangen an: Die volle Windel wegziehen, säubern, den Körper im Bett aufsetzen, Pause, ihn auf beide Füße stellen. Nun der Augenblick, in dem Noy dasteht und zu Boden blickt. Als müsse er darüber nachdenken, ob sein Leben diese Anstrengung noch wert ist.
Es ist absolut still und Noy scheint sehr einsam. Ich lege die Hand auf seinen Nacken und er tippelt los, Richtung Toilette. Er grinst, er hat sich entschieden. Mit nur einem Stopp die zehn Meter zum Bad schaffen, ihm unter die Arme greifen und auf die Klobrille platzieren. Noy unternimmt einen schwachen Versuch, mich abzudrängen, ein Gefühl von Scham holt ihn wohl ein. Ich bleibe, zu groß die Gefahr, dass sein eckiger Hintern in die Schüssel rutscht. Noy entleert sich, mehrere Durchgänge, selbst der Stuhl ist eine infame Anstrengung. Anschließend hochhieven, waschen, trocknen, ein Handtuch umbinden, hinausgehen, Schritt für Schritt. Draußen der Himmel und die verdammt schöne Welt. Der Tod ist launisch // Bilder aus dem Aids-Hospiz. Heute befinden sich zweihundert Kranke in Prabat Nampu. Wer noch gehen und sich selber waschen kann, lebt in sauberen Baracken, mit Nasszelle und kleiner Veranda. Wer im Krankensaal liegt, befindet sich im Endstadium. Der Tod ist launisch, manchmal holt er sich sechs Stunden nach Einlieferung sein Opfer, manchmal nach sechs Monaten.
Bei einem persönlichen Besuch im Juni 2015 von Herrn Karl Wieland, Obmann der ÖBAHO, bei Herrn Dr. Alongkot Dikkapanyo konnte er sich persönlich davon überzeugen, dass hier Hilfe unabdingbar sei. Nach gemeinsamer Besprechung in unserer Organisation haben wir uns entschlossen einmal im Jahr dem Wat Prabat Namphu eine Spende zukommen zu lassen. Der unten angeführte Spendenbetrag wurde von Herrn Wieland spontan übergeben (ca. 800,– €).